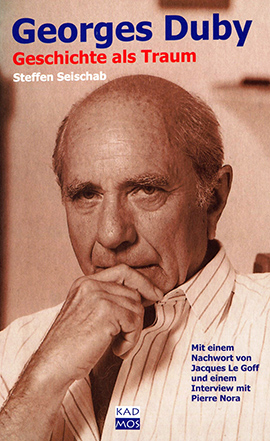Elmar L. Kuhn
Fundstücke - Georges Duby
Juni 2016
Georges Duby: Geschichte und Geschichtswissenschaft. Dialoge mit Guy Lardreau. Frankfurt: Suhrkamp, 1982 (stw 409)
Für den, der die Geschichte gewählt hat, bedeutet die Abreise Introversion, ein Durchgraben zu den Wurzeln hin. Er zieht sich in sich selbst zurück, er sucht Schutz, verkriecht sich. Schweigen, mit niemandem sprechen, lesen, entziffern, sich mit Schatten unterhalten. Im Grunde genommen ein Monolog. Ein Aufbruch, der keiner ist: sich in ein Zimmer einsperren, Archive, Bibliotheken, Zufluchtsorte; ein Flüstern, der Geruch alten Papiers. S. 46
Ich messe dem Ausdruck, der Schreibweise einen großen Wert bei – in meinem Fall, der Art und Weise, wie man Geschichte schreibt. Ich halte die Geschichtswissenschaft vor allem für eine Kunst, eine essentiell literarische Kunst. Die Geschichtsschreibung existiert nur durch ihren Diskurs. Damit sie gut ist, bedarf es eines guten Diskurses. Die Form ist in meinen Augen von größter Wichtigkeit. S. 49
Ich bemühe mich vor allem um die Klarheit des Ausdrucks: den Jargons unserer heutigen Humanwissenschaften stehe ich absolut feindlich gegenüber. Die Rhythmen, die Musikalität des Geschriebenen bedeuten mir jedoch sehr viel. S. 50
Sie werden nie alles gelesen haben, es wird immer Quellen geben, die Ihnen entgehen. Da kann man nichts machen. Was zählt ist die zündende Begeisterung, die den Historiker entflammen soll. S. 54
Georges Duby: Das Vergnügen des Historikers. In: Pierre Nora (Hg.): Leben mit der Geschichte. Frankfurt: Fischer, 1989, S. 65-99.
Nichts wies darauf hin, daß ich für jene absonderliche Tätigkeit bestimmt war, die darin besteht, sich zurückzuziehen, sich in die Stille zu versenken, um, schlecht, informiert, zwischen verwischten, verblaßten, disparaten Zeichen verloren, zu verstehen zu suchen, was sich Jahrhunderte früher zugetragen hat. S. 67
Ich hatte ein Territorium eingekreist: einen Raum, zur Hälfte ausgeleuchtet von dem, was von den Archiven der Abtei von Cluny und einiger benachbarter religiöser Anstalten heute noch übrig ist. Was diese zerstreuten Quellen sehr unvollständig dem Blick darboten, war nichts anderes als eine Landschaft, diesmal eine gesellschaftliche. Trotzdem wollte ich sie auf die sichtbare Landschaft projizieren, auf das was ich auf diesem Boden so gut kannte und liebte, um in der Komplexität ihres Erscheinungsbildes und ihres Zusammenhalts den Ursprung und die Entwicklung der Beziehungen zu erkennen, die einst in jenen Dörfern, auf jenen Feldern, in jenen Weinbergen und Wäldern, die ich in alle Richtungen durchstreift hatte, Bauern und Krieger miteinander unterhalten hatten. Naturgemäß geben die Urkunden wenig Aufschluß über die ökonomischen Verhältnisse, viel über die Machtbereiche, über die Art, wie diese aufeinanderprallten, sich einander anpaßten, sich verschränkten. Die Studie zeigt folglich die in einem Mosaik von Ackerflächen verwurzelte Anordnung der verschiedenen Formen der Macht. S. 86f.
Georges Duby: Eine andere Geschichte. Stuttgart: Klett-Cotta, 1992
Sehr viel fleischlicher, sinnlicher und vor allem nützlicher als die oberflächliche Geschichte herausragender Individuen wie Fürsten, Generäle, Prälaten oder Finanzmänner, deren Entscheidungen das Ausbrechen der Ereignisse zu bestimmen scheinen, war meines Erachtens die Geschichte des einfachen Mensch, und ich spürte, daß es dringend notwendig war, diese Geschichte resolut in Angriff zu nehmen. Ich ahnte vor allem, daß die Gesellschaft genau wie die Landschaft ein System ist, dessen Struktur und Entwicklung von zahlreichen Faktoren abhängt, und daß die Beziehungen dieser Faktoren untereinander nicht die von Ursache und Wirkung sind, daß sie Korrelationen und Interferenzen bilden, daß es angebracht ist, sie in einer ersten Phase einen nach dem anderen zu untersuchen, da jeder einzelne dieser Faktoren sich nach seinem eigenen Rhythmus auswirkt und entfaltet, daß man sie aber unbedingt in ihrem unauflöslichen Zusammenhalt betrachten muß, um die Funktionsweise des Systems zu begreifen. S. 13
Ich war allein. Ich hatte endlich erreicht, daß ein Karton auf den Tisch gestellt wurde. Ich machte ihn auf. Was mochte er enthalten? Ich zog ein erstes Bündel heraus, schnürte es auf, ließ meine Hand zwischen die Pergamentblätter gleiten, nahm eines und entfaltete es. Das alles schon nicht ohne einigen Genuß: oft sind die Häute so zart, daß ihre bloße Berührung ein köstliches Gefühl vermittelt. Hinzu kommt der Eindruck, an einen exklusiven, geheimen Ort zu gelangen. In der Stille scheinen diese glattgestrichenen, ausgebreiteten Blätter den Geruch längst erloschenen Lebens zu verströmen. Man spürt tatsächlich die unmittelbare Gegenwart des Menschen, der vor achthundert Jahren zu einer Gänsefeder griff, sie in Tinte tauchte und sich bedächtig daran machte, Buchstaben aneinanderzureihen, wie gemeißelt, eine Inschrift für die Ewigkeit – und der Text liegt da, vor einem, unverändert. Wer mag seither einen Blick auf diese Wörter geworfen haben? Vier oder fünf Personen höchstens. Happy few. Ein weiteres, erregendes Vergnügen liegt in der Entzifferung, die im Grunde nur ein Geduldspiel ist. Am Ende eines langen Nachmittags besteht die Ausbeute in einer Handvoll Angaben, kaum nennenswert. Aber sie gehören dem allein, der es verstanden hat, sie aufzustöbern, und für ihn war die Jagd viel wichtiger als das Wild. Ist der Historiker der konkreten Realität, der Wahrheit, die er brennend zu erreichen sucht und die sich ihm stets entzieht, je näher, als wenn er diese aus der Tiefe der Zeit stammenden, wie herrenloses Gut nach einem vollständigen Schiffbruch an der Oberfläche treibenden Schriftreste, diese mit Zeichen bedeckten Objekte, die er berühren, riechen, mit der Lupe betrachten kann und die er in seinem Jargon „Quellen“ nennt, vor sich hat und mit eigenen Augen erforscht? S. 27f.
Was ich mir von meinen Streifzügen durch Feld und Wälder erhoffte, war ein fester, konkreter Zugriff auf das Reale, um mich zu vergewissern. Ich hatte das starke Bedürfnis, dieses fadenscheinige, durchlöcherte Gewebe, das ich Stück für Stück zu flicken versuchte, indem ich lateinische Wörter las, auf einen festen Untergrund zu heften, auf ein anderes Zeugnis, die Landschaft, die ebenso reich, in ihrem Reichtum aber ganz verschieden und ohne irgendeine Lücke lebendig im vollen Tageslicht zu sehen war – ähnlich wie wenn man die Fragmente einer verwitterten Freske, ehe sie zu Staub zerfallen, auf Leinwand befestigt. S. 41
Ich erlebte eine seltsame Verwandlung, eine Art Alchimie, die darin bestand, daß sich durch den Vergleich, die Vermischung, die Verschachtelung zahlloser Fragmente des Wissens, das ich aus den durchstöberten Büchern und Aktenbündeln bezogen hatte, ein Bild abzeichnete, das immer präziser wurde, das nach und nach Farbe und Gestalt annahm – das überzeugende Bild eines komplexen, sich entwickelnden, lebendigen Organismus: das Bild einer Gesellschaft. S. 57
Der Beruf eines Historikers ist mit dem eines Regisseurs zu vergleichen. Ist die Bühne einmal aufgebaut, die Kulisse eingerichtet, das Libretto geschrieben, geht es darum, das Schauspiel aufzuziehen, den Text weiterzugeben, ihm Leben zu verleihen, und genau das ist wesentlich: man merkt es, wenn man die Aufführung einer Tragödie, nachdem man sie gelesen hat, hört, wenn man sie dargestellt sieht. Dem Historiker kommt die gleiche vermittelnde Funktion zu: durch das, was er schreibt, die Glut, die ’Wärme‘ mitzuteilen, ‚das Leben selbst‘ wiederherzustellen. Aber täuschen wir uns nicht: dieses Leben, das er einflößen soll, ist sein eigenes. Und es gelingt ihm umso besser, je empfindsamer er ist. Er muß seine Leidenschaft in Zaum halten, aber ohne sie darum zu ersticken, und er erfüllt seine Rolle umso besser, wenn er sich hier und dort etwas von diesen seinen Leidenschaften mitreißen läßt. Weit davon entfernt, ihn von der Wahrheit zu entfernen, geben sie ihm die Möglichkeit, sich ihr zu nähern. Der trockenen, kalten, unbeirrbaren Geschichte ziehe ich die leidenschaftliche Geschichte vor. Und ich bin fast geneigt zu glauben, daß sie wahrer ist. S. 64
Die Kunst, das Schreiben und die Geschichte. Ein Interview von Pierre Nora mit Georges Duby. In: Steffen Seischab: Georges Duby. Geschichte als Traum. Berlin: Kadmos, 2004.
Als ausgebildeter Geograph gehe ich von dem Prinzip aus, dass die sozialen Beziehungen zu einem guten Teil gleichermaßen durch das Ökosystem wie durch die physische, mentale und kulturelle „Umwelt“ bestimmt werden.
… die Verteilung der Machtbefugnisse in der Geschichte der Gesellschaften eine entscheidende Bedeutung einnimmt. Dies hat mich dazu gebracht, über die Macht und die Rolle immaterieller, ideologischer, intellektueller und kultureller Faktoren nachzudenken. S. 142
Ich bin davon überzeugt, dass die Kunst Ausdruck einer sozialen Ordnung ist, der Gesellschaft als Ganzes, Ausdruck ihrer Überzeugungen und des Bildes, das sie sich von sich selbst und der Welt macht. Ein Monument sagt selbstverständlich ebensoviel wie Texte über die Vorstellungen der Menschen seiner Zeit aus, ja sogar mehr, weil es auf eine andere Weise Spricht. S. 146
Ich bin von einer Gesellschaft ausgegangen, die ich sozusagen von außen studierte, anhand von Quellendokumenten wie z. B. Urkunden, äußerst nüchternen und deshalb in Bezug auf die konkrete Realität sehr aussagekräftigen Quellen, die es mir ermöglichten, Schritt für Schritt zur Rekonstruktion eines Systems voranzuschreiten, … Dann aber ist mir bewusst geworden, dass es nicht nur das gesellschaftliche System als solches, sondern auch denkende und fühlende Individuen gibt.
Von da an habe ich meine ganze Energie darauf verwendet, von außen nach innen in die Tiefe vorzudringen und zu versuchen, die feudale Gesellschaft so zu sehen, wie sie aus der Perspektive eines Individuums erlebt wurde, so wie es sie sich vorstellte und über sie sprach. …
Ich versuchte, in die Haut der Menschen, die ich beobachtete, zu schlüpfen, so wie sie zu denken und zu empfinden. / … mich interessiert der Zeuge mehr als das, was er glauben machen will. S. 157f.